
Der Geburtstag meiner Oma. Ein Bild, wie viele es kennen. Die Familie versammelt um den gedeckten Kaffeetisch. Nette und meist alltägliche und belanglose Gesprächsthemen. Doch plötzlich – und im Nachhinein weiß keiner mehr so wirklich, wie es dazu kam – schlägt die Stimmung um. Wo vorher in kleinen Grüppchen über alles Mögliche geredet wurde, dominiert jetzt nur noch ein Thema die gesamte Tischgesellschaft. Da gibt es dann die, die eifrig diskutieren und Position beziehen. Die, die ab und zu einen Aspekt mit einbringen und ihre Meinung in vagen Formulierungen zum Ausdruck bringen und dann die, die fast schon betreten zuhören, neuen Kaffee kochen und beschwichtigend einwerfen, dass man doch nicht laut werden müsse, worauf die Wortführer zumeist protestieren und sagen: „Wir streiten nicht, wir diskutieren!“. Und dann natürlich noch die ganz Radikalen, die in den Nebenraum flüchten, um das laufende Fußballspiel zu verfolgen.
An diesem Nachmittag ging es um Frauen, die ein Kopftuch tragen. Doch eigentlich ging es um viel mehr. Um Kategorien, um Bilder von Menschen, um Vorurteile und die große Frage, was es heißt eine emanzipierte Frau zu sein und wie man dies nach Außen trägt. Was nach diesem Gespräch blieb? Wir wollten einander verstehen, und wenn nicht zu einer gemeinsamen Meinung kommen, dann doch wenigstens ein Verständnis für die Haltung des jeweiligen Anderen erlangen. Doch letztlich blieb es bei einem ernüchternden, unangenehmen Gefühl und einer betretenden Stimmung. Und Schweigen.
Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Journalistin und politische Aktivistin Kübra Gümüşay ihr erstes Buch mit dem Titel „Sprache & Sein“, in welchem sie sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Sprache unser Denken prägt und den gesellschaftlichen und politischen Diskurs mitbestimmt. Gümüşay arbeitet mit dem Bild der Gesellschaft als ein Museum, dem „Museum der Sprache“. Doch wer kuratiert dieses Museum?
Innerhalb dieses Ortes gibt es zunächst die Unbenannten. Sie stellen die Norm dar, den Maßstab, und benötigen keinen Namen, da es selbstverständlich für sie ist, dazuzugehören. Angehörige dieser Gruppe der Unbenannten nutzen ihre Macht, um alle diejenigen zu benennen, die ihnen irgendwie anders und fremd erscheinen, da sie in welcher Form auch immer, von der (konstruierten) Norm abweichen. Die Benannten werden also analysiert, inspiziert und schließlich kategorisiert. Sie erhalten aufgrund von Merkmalen, die die Unbenannten für (be)nennenswert halten, einen Kollektivnamen, sodass eine Gruppe von Menschen zu einer konstruierten Kategorie wird, ihre Individualität verlieren und zu Ausstellungsstücken, zu Objekten gemacht werden. „Dies ist der Moment“, so Gümüşay, „wo Menschen in unserer Sprache entmenschlicht werden, wo sie nicht mehr Individuen sein können, wo sie keine Fehler und Makel haben können, ohne dass diese Fehler und Makel auf alle anderen ihrer Kategorie übertragen werden“.
Gümüşay plädiert jedoch nicht für eine radikale Abschaffung von Kategorien. Vielmehr betont sie, wie notwendig diese für die Menschen sind, um die Welt um uns herum begreifbar zu machen und uns gegenseitig zu verstehen. Kategorien werden erst zu einem Problem, wenn sie an einen „Absolutheitsglauben“ geknüpft sind. Wenn die Unbenannten meinen, die Macht zu haben, einen anderen Menschen gänzlich in einer Kategorie verstehen zu können.
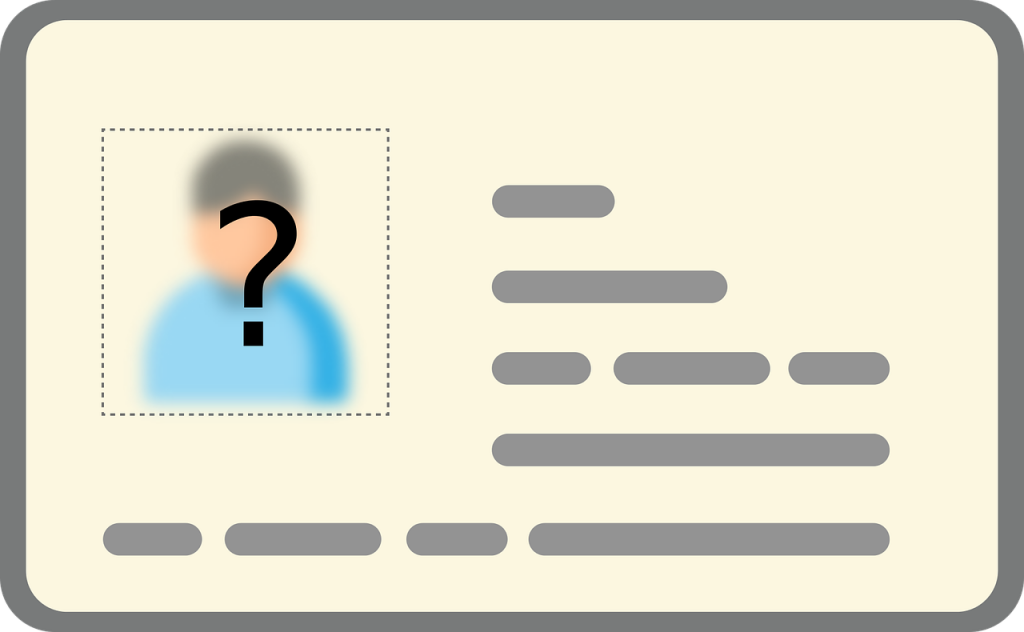
Gümüşay selbst hat sich lange Zeit als „Pressesprecherin ihrer eigenen Kategorie“ wahrgenommen und berichtet von dem Gefühl, sich oder die Kategorie, erklären und rechtfertigen können zu müssen. Der Name wird zum Käfig. Statt im Rahmen dieser Machtverhältnisse zu reagieren, geht es ihr heute darum, eine Sprache zu finden, die Menschen Menschen sein und frei sprechen lässt.
Um das Thema in einem weiteren Kontext zu untersuchen und zu verstehen, habe ich mich mit den Theorien und Ansätzen Judith Butlers auseinandergesetzt. Vielen von euch mag Butler ein Begriff sein, dennoch möchte ich sie und ihr Schaffen kurz vorstellen. Judith Butler (*1956) in Cleveland, Ohio, studierte Philosophie in den USA und Deutschland und ist heute Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Rhetorik und Komparatistik in Berkeley. Butler setzt sich in ihren sozial-philosophischen Werken, welche den Ansätzen des Poststrukturalismus folgen und im Rahmen feministischer Theorien zu lesen sind, mit den Prozessen auseinander, welche Subjektivität konstituieren. Eine der zentralen Fragen, die sich Butler stellt und zu ergründen versucht, ist, wie im Rahmen eines gesellschaftlichen Macht-Diskurses, Kategorien konstruiert werden und welche Möglichkeiten des (Zusammen-) Lebens sich daraus ergeben. Kurz: wie können wir eine gerechtere und freiere Gesellschaft unter Anbetracht der sozialen, gesellschaftlichen Bedingungen schaffen?
Sowohl Butler als auch Gümüşay setzen sich mit der Macht und Wirkung von Sprache, dem Akt des Sprechens selbst und der Bedeutung für das eigene Subjektverständnis auseinander. Beide Autorinnen verfolgen mit ihren Arbeiten ein ähnliches Ziel: die machtvolle Wirkung jener eingrenzenden Strukturen aufzudecken, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und durch ein bewusstes und emanzipiertes Sprechen und Verhalten, einen Raum zu schaffen, in der Jede*r sein kann. Doch welche konkrete Rolle spielt Sprache hierbei? Wie wirkt sie in dem Prozess der Subjektwerdung? Judith Butler versteht Sprache als eine von mehreren Ordnungen, die uns Begriffe und sprachliche Gesetzmäßigkeiten vorgibt und somit Teil eben dieses Prozesses ist, da die Begriffe des Diskurses unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit strukturieren. Butler schreibt der Sprache somit eine produktive und vor allem performative Wirkung innerhalb der herrschenden Machtverhältnisse zu,

Butlers Verständnis eines Subjektbegriffs ist zentral für ihre kulturtheoretischen Arbeiten. An dieser Stelle kann jedoch nicht im Detail auf die betreffende Kulturtheorie eingegangen werden. Es sei nur so viel gesagt: Für Butler unterscheidet sich der Begriff des Subjekts von dem des Individuums grundlegend. Ersteres sei eine sprachliche, durch Strukturen hervorgebrachte Kategorie. Letztere sind Akteure, die das Subjekt besetzen und nur dadurch verständlich werden, soweit sie gleichsam zunächst in Sprache eingeführt werden. Das Subjekt ist also eine Konstruktion, welches im Prozess der Unterwerfung unter sozialen Bedingungen (Normen) entsteht, sich wohl aber zu diesen widerständig verhalten kann.
Ähnlich wie Kübra Gümüşay meint jedoch auch Judith Butler nicht, dass Identitätskategorien an sich problematisch und somit abzuschaffen seien. Butler weist ihnen vielmehr eine produktive Wirkung zu, da sie mit Normen einhergehen, die uns zu handlungsfähigen Subjekten werden lassen. Nichtsdestotrotz sind diese Identitätskategorien immer auch mit der Ausschließung von anderen Möglichkeiten sich selbst zu definieren verbunden und somit als unvollständig und beschränkt zu bewerten.
Seiten 1 2
Danke für diesen Artikel. Ich habe diese These mit den “Benannten” jetzt ein wenig besser verstanden al beim Lesen des Buches (das ich im Übrigen nicht besonders erhellend fand, dazu waren mir da zu wenig Zusammenhang und zu viel Zitate und name-dropping.
Aber ist das der – kontraintutive – Clou: Dass die Mehrheit die “Unbenannten” sind. Und Benennung damit zum Stigma wird. das widerspräche doch etwa dem Prinzip von Sichtbarmachung, dem Eine-eigene-Stimme finden usw. Ich verstehe das immer noch nicht so richtig, oder denke ich nicht dialektisch genug. Im Moment der Benennung erst wird etwas doch Wirklichkeit- und Ungerechtigkeit zugleich, das stimmt. aber sonst “ist” es nicht. Aber strukturelle Diskriminierung wirkt auch ohne Benennung.
Der Artikel ist sehr vorsichtig und beschreibend. Wie eine These, ein Vorschlag, eine Position nicht schön? Eine Stimme?