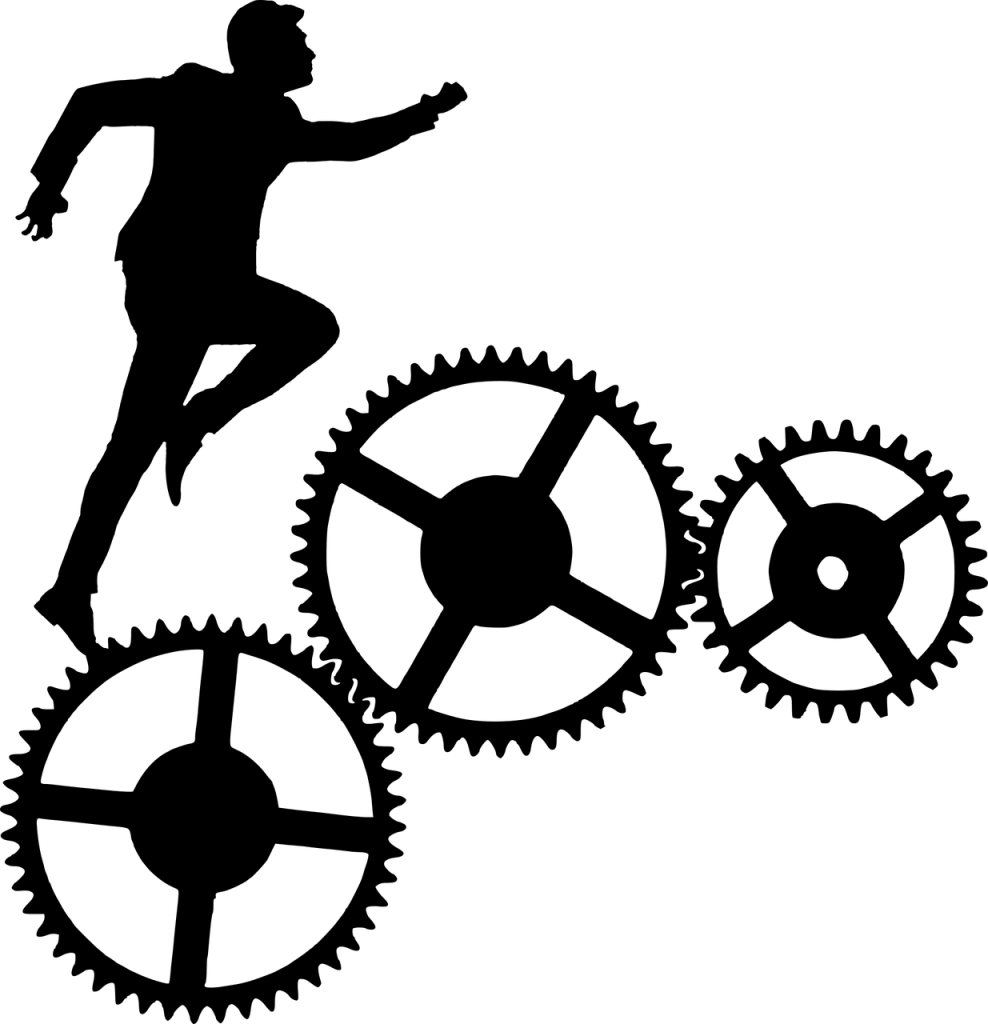
Anfang des Jahres machten Nachrichten aus Finnland auf der ganzen Welt Schlagzeilen; die Regierung diskutiere die Einführung einer Vier-Tage-Woche mit nur sechs Stunden Arbeit pro Tag. Kurze Zeit darauf wurde jedoch klargestellt, dass es sich um eine veraltete Äußerung der Ministerpräsidentin Sanna Marin handele, die noch dazu nie von verkürzter Woche und verkürztem Tag gleichzeitig gesprochen habe. Die FAZ titelte anschließend in einem Kommentar von Florentine Fritzen „Spinnen die Finnen?“ und verurteilte die gesamte Idee als „falsches Signal“ der Politik. Die Wirtschaft würde unter einem starren Beschluss wie der Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich leiden und schließlich gäbe es ja auch Menschen, die ihren Beruf so sehr schätzen, dass sie ihm die üblichen vollen vierzig Stunden pro Woche schenken wollen. Dabei wird die eigentliche Problematik schlicht übersehen. Anstatt sofort zu fragen, welche Folgen eine Vier-Tage-Woche mit sich bringen würde, sollte zuerst beobachtet werden, weshalb die Idee überhaupt so gut ankommt. Wieso entfacht ein Gerücht so brennende Diskussionen, wenn es doch laut FAZ für die meisten Menschen immens wichtig ist, ihrem Beruf 40 Stunden ihrer Woche zu widmen? Es gibt wenig Dinge, mit denen man sich so oft und langwierig befasst, wie mit den Inhalten seines Berufes. So ist es kein Wunder, wenn sie Bestandteile der eigenen Identität werden. Man fühlt sich gut, wenn man einen produktiven Tag auf der Arbeit verbracht hat, möglichst viele Aufgaben schnell und fehlerfrei bewältigen konnte. Auf der anderen Seite bekommt man Gewissensbisse, wenn man länger als drei Tage fehlt, eventuell die Kollegen mit unerledigten Aufgaben alleine lässt.
Der Beruf und die damit verknüpfte erbrachte Leistung darf nicht die Antwort auf die Frage sein, wer man eigentlich ist. Der Berliner Philosoph Byung-Chul Han diskutiert in seinem Essay „Müdigkeitsgesellschaft“ eben jene Aufopferungsbereitschaft der arbeitenden Personen des 21. Jahrhunderts und untersucht die Frage, was geschieht, wenn die Leistung zum Grundstein der Persönlichkeit wird. Für Han ist Leistung das persönliche Gebot jederzeit zu geben, so viel man kann. Hans Leistungssubjekt ist eine Schablone für den modernen Menschen: ein Mensch, der zwar nicht mehr gezwungen ist zwölf Stunden in gesundheitsgefährdender Umgebung für geringen Lohn zu arbeiten, dafür aber seine Arbeit mit nach Hause nimmt; ein Mensch, der sich mit seiner Arbeit identifiziert und für den Leistung nichts ist, was eine äußere Instanz abverlangt, sondern wonach sein Innerstes strebt.1 Das Leistungssubjekt sei „frei von äußerer Herrschaftsinstanz, die es zur Arbeit zwingen oder gar ausbeuten würde. Es ist Herr und Souverän seiner selbst. So ist es niemandem, bzw. nur sich selbst unterworfen.“ Leistung begrenzt sich nicht mehr auf die Arbeit, sondern nimmt jeden Aspekt des Lebens für sich ein. Alles muss einem Zweck dienen, jedes Hobby hat das Potenzial, gewinnbringend ausgeschlachtet zu werden. So sei der Entfall der Herrschaftsinstanz kein Zeichen der Freiheit, sondern lediglich der „freie Zwang zur Maximierung der Leistung.“ Es handle sich um eine paradoxe Freiheit, welche sich in der Depression manifestiere.
Die USA des 20. Jahrhunderts sind das perfekte Beispiel einer modernen Leistungsgesellschaft. Jedermann scheint die gleichen Möglichkeiten auf Ruhm und Reichtum gehabt zu haben, Redewendungen wie „vom Tellerwäscher zum Millionär“ haben sich etabliert. Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch immer eine erhebliche Leistung gewesen. Wer nichts leistet, verdient nichts und ist wertlos in einer Gesellschaft voller Macher und Arbeitstiere. An dieser Stelle wird die Ambiguität des Begriffs deutlich. Auf der einen Seite steht Leistung für unbegrenzte Möglichkeiten, auf der anderen ihr Fehlen für Versagen und Faulheit. Das Leistungssubjekt, also derjenige Mensch, der Leistung erbringen könnte, ist allein zuständig für die Erfüllung seines Schicksals. In den Industriestaaten beginnt diese Denkweise im Grundschulalter. In jüngsten Jahren werden Kinder indoktriniert, sich mit den Leistungen der Mitschüler in Form von Noten zu vergleichen und sich immer wieder gegenseitig zu überflügeln. Sowohl von Lehrern als auch von Eltern wird der höchste Schulabschluss als absolutes Ziel gesetzt, das unter allen Umständen erreicht werden muss, um wiederum ein erfolgreiches Leben führen zu können. Leistung und Erfolg sind von Anfang an gekoppelt – ohne Leistung kein erfolgreiches Leben. Sobald die Leistung zu einem Maßstab wird, an dem der Wert eines Menschen gemessen werden soll, kann sie nicht mehr als motivierende, treibende Kraft gesehen werden.
1 Vgl. Han, B.-C.: Müdigkeitsgesellschaft, S. 23.
Seiten 1 2